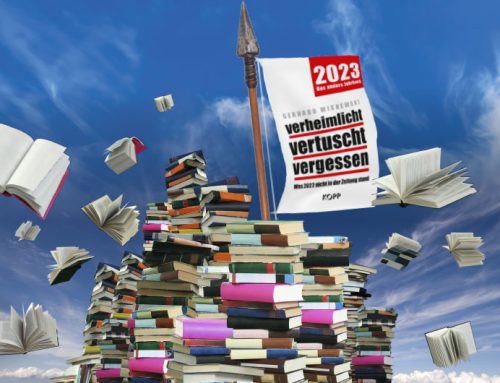Andreas von Rétyi
Erst Nobelpreis, jetzt Ethikpreis – Das wahre Gesicht von Obama

Das Establishment treibt wieder neue Blüten. Ausgerechnet der ehemalige US-Präsident Barack Obama nimmt einen Preis für »Ethik des Regierens« entgegen. Schon wenige Beispiele belegen retrospektiv, wie »ethisch« der Ex-Präsident wirklich agiert(e).
Es war die Geschichte vom ver(f)logenen Zauber. Barack Obama hatte viel versprochen und beinahe nichts davon gehalten. Seine immerhin achtjährige Amtszeit – was hat sich davon eigentlich eingeprägt? Zumindest wenig Ethisches.
Dennoch, Obama nahm am 7. September in Illinois feierlich eine Auszeichnung für ethische Staatsführung entgegen. Das ist kaum weniger fragwürdig als die Verleihung des Friedensnobelpreises zum Amtsantritt. Was folgte, war eine einzige große Enttäuschung, da half auch das vielzitierte Charisma nicht weiter. Obama verstand es bekanntlich besonders gut, sich als glühender Verfechter für Frieden und Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit zu präsentieren. Zunächst umgab ihn eine leuchtende Aura der Glaubwürdigkeit. Immer noch ruft er dazu auf, massiv gegen eine sich vorgeblich erhebende Phalanx autoritärer Politiker und Verfahrensweisen vorzugehen, doch sein Glanz lässt sich kaum mehr restaurieren.
Obama gibt sich gerne als ethisches Vorbild, als Fels in der Brandung unlauterer Politik. Nur überzeugt das alles kaum mehr und dürfte die US-Demokraten aktuell wenig weiterbringen. Die Obama-Administration hat schlichtweg zu viele mehr oder minder heimliche Skandale produziert – und genau diese alten Skelette tauchen anlässlich unangebrachter Preisverleihungen besonders gern wieder aus den düsteren Kellern auf.
Es war doch so: Obwohl George W. Bush und Barack H. Obama als Persönlichkeiten kaum stärker kontrastieren konnten, änderte sich an der Politik so gut wie nichts. Allein diese Tatsache belegt das große Theater, das der Öffentlichkeit vorgespielt wird. Und wer geglaubt hatte, Obama würde menschlicher regieren, durfte sich eines Besseren belehren lassen. Denn ganz im Gegenteil dazu agierte er vielfach sogar noch radikaler als sein Vorgänger.

Wasser und Wein
Wenn sich Obama einmal wöchentlich – und fast immer dienstags – im abgeschotteten Situation Room einfand, entschied er wieder einmal über Leben und Tod. Bald sprach man vom »Terror Tuesday«, denn hier entschied der »Chef« über tödliche Attacken auf mutmaßliche Terroristen. Obama befasste sich auf diesen Sitzungen mit geheimdienstlich erstellten Power-Point- Steckbriefen potenzieller al-Qaida-Terroristen und arbeitete sich durch die Todeslisten des Pentagons. Was folgte, waren Drohnenattacken, die auch Unschuldige töteten.
Der Friedensnobelpreisträger von 2009 führte seine Geheimkriege unbeirrbar und unerbittlich durch. In den ersten knapp 3 Jahren nach seinem Amtsantritt, so zumindest ermittelte die New America Foundation, kamen bei Drohnenangriffen rund 1500 Menschen in Pakistan ums Leben. Die Stiftung nennt Vergleichszahlen aus der Zeit zwischen 2004 und 2008 unter Bush: 383 Tote bei entsprechenden »Antiterror«-Aktionen. Obama, ein typischer politischer Prediger, der Wasser von Wein offenbar nicht zu unterscheiden vermag. Von Ethik keine Spur. Genau wie seine Vorgänger lässt er sich auch als Privatmann bei jedem öffentlichen Auftritt die Nase gehörig vergolden. US-Medien berichteten, dass er für eine Rede vor Wall-Street-Bankern rund 400 000 Dollar Honorar erhielt. Kein Einzelfall. Überhaupt: Schon lange kassieren US-Präsidenten enorme Summen für diverse Aktivitäten nach ihrem Amtsausscheiden. Doch die Gagen Obamas erreichten sie kaum jemals.

Eliten kassieren, wo immer es geht
George W. Bush strich jeweils 100 000 bis 175 000 US-Dollar pro öffentlichem Auftritt ein. In den Jahren zwischen 2009 und 2015 sprach er bei mehr als 200 Veranstaltungen. Auch die Clintons sahnten buchstäblich »selbstredend« mächtig ab, was durchaus Kritik provozierte – allerdings wohl kaum ein größeres Problem für die beiden. Hillary Clinton wurde pro Rede vor Goldman-Sachs-Repräsentanten um 225 000 Dollar reicher, ihr Mann sammelte mit seinen postpräsidentiellen Auftritten insgesamt deutlich über 60 Millionen Dollar. Für manche Kreise alles womöglich nur Trinkgelder.
Dennoch, auch in den hinsichtlich Superlativen geübten USA, wo Reichtum nur selten Missgunst weckt und gewiss nicht negativ belegt ist, stößt die Geldgier der Spitzenpolitiker zunehmend übel auf. Sie bleibt wie eh und je Beleg für die Bereitschaft der herrschenden Kräfte, sich für Geld zu allem zu prostituieren. Ethik und Moral bleiben dabei auf der Strecke.
Und das führt direkt zurück zu Barack Obama, dem nunmehr 28. Empfänger des begehrten Douglas Award der Universität von Illinois. Der Ethikpreis – für einen Ex-Präsidenten der USA, einen Mann, der für zahlreiche Skandale verantwortlich zeichnet, so auch durch seine Rolle, die er bei der verdeckten »Operation Fast and Furious« spielte.
Handeln von Heuchelei geprägt
Eine zuständige Behörde sollte dabei unterstützt werden, in den USA operierende Drogenkartelle auszuheben. Stattdessen wanderten rund 2000 Waffen über die Grenze nach Mexiko und direkt in die Hände von Kriminellen. Obama versuchte, 20 000 Seiten Dokumente zurückzuhalten. Auch sein Kampf gegen ISIS war von Heuchelei geprägt. Dabei verharmloste er die Bedrohung trotz sich häufender Terrorakte auf bemerkenswerte Weise. Jeffrey Goldberg, der Chefredakteur des US-Traditionsmagazins The Atlantic, kommentierte dazu: »Obama glaubt, dass sich der Schlagabtausch innerhalb einer einzigen Zivilisation abspielt und dass die Amerikaner zuweilen der Kollateralschaden in diesem Kampf zwischen muslimischen Neuerern und muslimischen Fundamentalisten sind.«
In der Obama-Administration folgte ein Skandal dem anderen. Für die Welt eher heimlich, und doch völlig real, ob es sich nun um ausgemachte Lügen zum Iran-Deal drehte oder aber um weitreichende Spitzelaffären. Dabei hatte Obama sein Amt unter Vorgabe hoher ethischer Standards angetreten. Er sprach von einer »neuen Ära der Offenheit«, ließ Geschenke von Lobbyisten nicht mehr zu und fror Gehälter von über 100 000 Dollar bei Mitarbeitern des Weißen Hauses ein. Sein Argument: »Amerikanische Familien müssen den Gürtel enger schnallen, also muss Washington das auch.« Für Obama selbst galt das alles offenbar nie.
Dieser Beitrag erschien zuerst bei Kopp Exklusiv.
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit einem Abo, falls Ihnen dieser Beitrag gefallen hat.