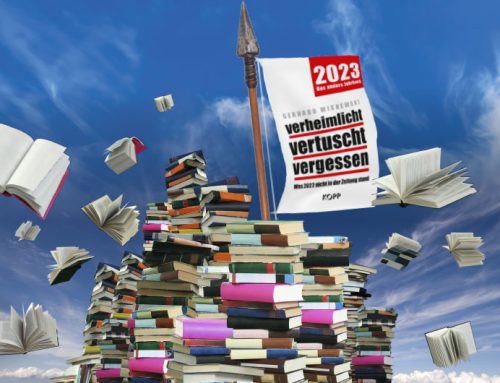Michael Brückner
Österreichs EU-Ratsvorsitz:
Von Frontex bis zum Brexit
Von Frontex bis zum Brexit

Österreich übernimmt am 1. Juli in einer kritischen Phase die EU-Ratspräsidentschaft. Auf der Agenda stehen brisante Themen. Doch verglichen mit früher, hat die Ratspräsidentschaft nicht mehr viel zu sagen. Noch-Kanzlerin Merkel wird’s freuen, denn ihr Verhältnis zur neuen Regierung in Wien gilt als unterkühlt.
Vor gut 24 Jahren stimmten die Österreicher über eine Mitgliedschaft ihres Landes in der Europäischen Union (EU) ab. Mit überwältigender Mehrheit hätten sie mit »Ja« votiert, wird heute kolportiert. Nun gut, die Mehrheit war mit 66,6 Prozent sicher deutlich, aber immerhin war jeder dritte Österreicher dagegen. Am geringsten war die Zustimmungsquote damals in Tirol (56,7 Prozent), am höchsten im Burgenland (74,7). Im Vorfeld der Volksabstimmung hatten die Parteien der großen Koalition von SPÖ und ÖVP massiv für einen EU-Beitritt geworben; FPÖ, Grüne und mehrere kleinere Parteien waren dagegen. Im Jahr 1995 trat Österreich dann der Europäischen Union bei und hatte seither bereits zweimal die EU-Ratspräsidentschaft inne. Am 1. Juli beginnt nun die dritte Ratspräsidentschaft unter dem jungen Bundeskanzler Sebastian Kurz und seinem Vize Heinz-Christian Strache (FPÖ).

Heikle Themen für Österreich
Von den ersten beiden Präsidentschaften ist eigentlich nur jene im Jahr 1998 in Erinnerung, als sich die EU-Staats- und Regierungschefs im pittoresken Pörtschach am Wörthersee trafen und dort Yassir Arafat empfingen. Was ist von der dritten Präsidentschaft Österreichs zu erwarten – in einer Zeit, da immer mehr Bürger dem teuren Bürokratiemonster EU den Rücken kehren oder – wie im Fall der Briten – sogar austreten? Keine Frage, auf der Agenda im zweiten Halbjahr 2018 stehen brisante Themen, und Kanzler Kurz hat sich viel vorgenommen. Doch längst haben die Regierungsvertreter jener Länder, die jeweils für sechs Monate die Ratspräsidentschaft übernehmen, nicht mehr viel zu sagen. An ihre Stelle sind EU-Funktionäre getreten, die kein Bürger in ihre Ämter gewählt hat.
Früher fiel der Europäische Ratsvorsitz dem Regierungschef jenes Landes zu, das aktuell den Ratsvorsitz innehatte. Heute bekleidet dieses Amt der »Ständige Ratsvorsitzende« Donald Tusk. Den Vorsitz im Außenministerrat führt nicht die österreichische Außenministerin Karin Kneissl, sondern die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Und wenn sich die EU-Finanzminister treffen, hat nicht der Österreicher Hartwig Löger, sondern der Eurogruppenchef Mario Centeno den Vorsitz. Sogar bei einem der wichtigsten Themen während der österreichischen Ratspräsidentschaft, dem Finalisierungsprozess der Brexit-Verhandlungen, führt kein Österreicher die Gespräche, sondern Michel Barnier, der von Rat und Kommission dazu beauftragt wurde. Es ist unübersehbar: Der Einfluss der jeweiligen Ratspräsidentschaft ist in den vergangenen Jahren deutlich geringer geworden.

Diplomaten rechnen mit neuem »Flüchtlings-Tsunami«
Dennoch wird die Regierung Kurz/Strache in den nächsten sechs Monaten wichtige Themen anpacken, mit denen sie sich in Brüssel sicher nicht nur Freunde machen dürfte. So will die Wiener Regierung die Zeit ihres EU-Vorsitzes nutzen, um die stärkere Überwachung der Außengrenzen der Europäischen Union durchzusetzen. »Erst wenn wir die Grenzen nach außen effektiv schützen können, werden wir die Grenzen nach innen wieder abbauen können«, bringt Kanzler Kurz seine Strategie auf den Punkt. Mit diesem Thema soll sich ein EU-Gipfel im September beschäftigen.
Vor allem geht es darum, die EU-Grenzschutzagentur Frontex personell und finanziell zu stärken. Bislang war eine Aufstockung des Frontex-Personals erst bis zum Jahr 2027 geplant. »Entscheidend ist, dass wir beenden, dass Menschen quer durch Europa ziehen, um dann in Deutschland, Schweden oder Österreich einen Asylantrag zu stellen«, betonte Kurz unlängst. Der Regierungschef sprach sich ebenfalls dafür aus, Flüchtlingslager außerhalb der EU einzurichten. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass Migranten überhaupt die Reise nach Europa antreten. Tatsächlich rechnen Diplomaten und Sicherheitsexperten schon bald mit einem neuen »Flüchtlings-Tsunami«, der dieses Mal die Route über Albanien wählen könnte.
Neben dem Brexit und der Migrationspolitik wird während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft der »Mehrjährige Finanzrahmen 2021–2027«, kurz EU-Budget, im Vordergrund stehen. Dieser sieht Ausgaben in Höhe von knapp 1,3 Billionen Euro vor. Vor allem Deutschland hat in vorauseilendem Gehorsam schon frühzeitig zugesagt, künftig mehr Geld nach Brüssel zu überweisen, um die Ausfälle durch den EU-Austritt Großbritanniens zum großen Teil auszugleichen. Die Regierung von Sebastian Kurz hingegen ist bisher strikt gegen den Etatentwurf der EU-Kommission, ebenso die Mitgliedstaaten Dänemark, Schweden und die Niederlande.
Was verdient ein EU-Kommissar?
Stattdessen schlägt Kurz Sparmaßnahmen vor. Dazu gehört zum Beispiel die Verkleinerung der EU-Kommission. Tatsächlich gibt es keine schlüssigen Argumente, weshalb sich Brüssel sage und schreibe 28 EU-Kommissare leisten muss. Künftig soll es nach den Vorstellungen des österreichischen Kanzlers nur noch 18 Kommissare geben, die nach dem Rotationsprinzip jeweils von Vertretern anderer Staaten abgelöst werden. Ein EU-Kommissar verdient (Stand: Dezember 2017) mit Zulagen brutto fast 26 240 Euro pro Monat, im Jahr also 314 880 Euro. Die sechs Vizepräsidenten der EU-Kommission kommen auf ein Brutto-Monatseinkommen einschließlich Zulagen von jeweils über 30 300 Euro, Jean-Claude Juncker als Kommissionspräsident und der ständige EU-Ratspräsident Donald Tusk beziehen jeweils rund 32 200 Euro pro Monat. Fielen zehn Kommissare weg, lägen die Einsparungen somit schon jährlich im siebenstelligen Bereich.

Die österreichische Regierung spricht sich darüber hinaus dafür aus, den sogenannten »europäischen Wanderzirkus« zu beenden. Gemeint sind damit die beiden Standorte des EU-Parlaments in Brüssel und Straßburg. Dies macht ständige Umzüge nötig und verursacht Jahr für Jahr Kosten in dreistelliger (!) Millionenhöhe. Neu ist dieser Vorschlag nicht, er wurde in den vergangenen Jahren immer wieder in die Diskussion eingebracht, scheiterte bislang aber stets am Veto Frankreichs. Aus Prestigegründen will die französische Regierung den Standort in Straßburg behalten. Daran dürfte sich auch künftig nichts ändern.
Ebenfalls nicht gerade neu ist die Forderung nach mehr Subsidiarität in Europa. Das bedeutet, dass Brüssel nur jene Themen und Zuständigkeiten an sich ziehen darf, die nicht effektiver und bürgernäher auf unteren Ebenen erledigt werden können, also zum Beispiel in den Mitgliedstaaten oder Regionen. In den vergangenen Jahrzehnten wurde diese Forderung immer wieder erhoben, doch niemals konsequent umgesetzt.
Umstrittene Digital-Richtlinien
Schließlich wird sich Wien noch mit den »Hinterlassenschaften« der bulgarischen Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2018 herumplagen müssen – vor allem im Digitalbereich. Hierzu gehört die höchst umstrittene EU-Copyright-Richtlinie, mit deren Hilfe Onlineplattformen zu sogenannten Upload-Filtern verpflichtet werden sollen, die nach Ansicht von Kritikern zu mehr Überwachung beitragen.
Nicht zuletzt wird es interessant sein, inwieweit Österreich als »Brückenland« zwischen Westeuropa und den Staaten der Visegrád-Gruppe (Ungarn, Tschechien, Slowakei und Polen) versuchen wird, die offenkundigen Differenzen zwischen beiden Teilen der EU zu entschärfen. In Brüssel herrscht mittlerweile Angst vor einer sogenannten »Orbánisierung« der EU. Zuletzt haben die Parlamentswahlen in Ungarn, Italien und Slowenien gezeigt, dass in großen Teilen der EU die Bürger eher weniger als mehr EU wollen. Diese EU-Skepsis versuchen Länder wie Deutschland und Frankreich mit noch mehr Europa-Euphorie zu ersticken.
Dieser Beitrag erschien zuerst bei Kopp Exklusiv.
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit einem Abo, falls Ihnen dieser Beitrag gefallen hat.